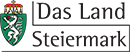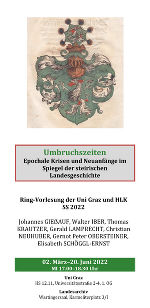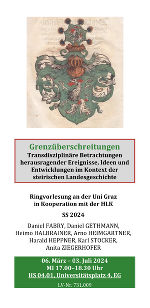„Umbruchszeiten“ zwischen Ausnahme und Normalität – eine Nachlese zur gleichnamigen Ringvorlesungskooperation der HLK mit der Universität Graz
Wernfried Hofmeister
Vorgeschichte und Fragestellungen
Als im Sommersemester 2022 die dritte[1] zweijährliche Ringvorlesung zwischen der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK) und der Universität Graz unter dem Titel „ Umbruchszeiten. Epochale Krisen und Neuanfänge im Spiegel der steirischen Landesgeschichte” begann, war dieses Thema fast beklemmend aktuell geworden: Nur wenige Tage zuvor hatte der russische Feldzug gegen die Ukraine begonnen![2] Dieser machtpolitische Hintergrund, der bis in den Hörsaal hinein spürbar war, verschärfte überaus dramatisch die Virulenz der aufzuwerfenden Vorlesungsfragen nach den Ursachen, Ausprägungen, Intensitäten, Häufungen und Zusammenhängen rund um historische Umbrüche. Zu fragen galt es ferner, wie derlei abrupte Verwerfungen etwa durch herrschaftliche, ökonomische, verwaltungstechnische oder soziale Prozesse in der Vergangenheit hatten bewältigt werden können und ob die erfolgreich angewandten Problemlösungsstrategien womöglich als eine Art von Fortschrittsmotor zu betrachten wären. Nicht zu vergessen die ganz allgemeine Frage, inwiefern sub specie historiae das Auftreten von Umbruchserscheinungen eher als die Regel denn als Ausnahme zu begreifen sei. (Abb. 1)
Umbruchszeiten. Epochale Krisen und Neuanfänge im Spiegel der steirischen Landesgeschichte” begann, war dieses Thema fast beklemmend aktuell geworden: Nur wenige Tage zuvor hatte der russische Feldzug gegen die Ukraine begonnen![2] Dieser machtpolitische Hintergrund, der bis in den Hörsaal hinein spürbar war, verschärfte überaus dramatisch die Virulenz der aufzuwerfenden Vorlesungsfragen nach den Ursachen, Ausprägungen, Intensitäten, Häufungen und Zusammenhängen rund um historische Umbrüche. Zu fragen galt es ferner, wie derlei abrupte Verwerfungen etwa durch herrschaftliche, ökonomische, verwaltungstechnische oder soziale Prozesse in der Vergangenheit hatten bewältigt werden können und ob die erfolgreich angewandten Problemlösungsstrategien womöglich als eine Art von Fortschrittsmotor zu betrachten wären. Nicht zu vergessen die ganz allgemeine Frage, inwiefern sub specie historiae das Auftreten von Umbruchserscheinungen eher als die Regel denn als Ausnahme zu begreifen sei. (Abb. 1)
Um solche geschichts‑ und gegenwartsrelevanten Aspekte einmal mehr am Beispiel des ‚Geschichtslabors Steiermark’ zu ergründen, kamen – in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Vorlesungseinheiten aus insgesamt sechs Fachbereichen – folgende Persönlichkeiten zu Wort: Johannes Gießauf (Mittelaltergeschichte), Christian Neuhuber (Deutsche Literaturgeschichte), Gernot Peter Obersteiner (Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte), Gerald Lamprecht (Jüdische Studien), Elisabeth Schöggl‐Ernst (Archivwissenschaften) sowie Walter Iber und Thomas Krautzer (Wirtschaftsgeschichte). (Abb. 2) Weit über 100 Studierende waren in diese fächerübergreifende Freifachlehre inskribiert, viele von ihnen durchgehend anwesend, so wie der Verfasser dieser Zeilen, der seitens der HLK abermals in enger Kooperation mit dem Vizerektorat für Lehre an der Uni Graz als Themenfinder, Lehrveranstaltungskoordinator und Herausgeber aller verschriftlichten Beiträge fungieren durfte.[3] Persönliche (keineswegs nur negative) ‚Umbrüche’ seitens einiger Vortragender bewirkten diesmal, dass das Buch zur Vorlesung nicht schon vor Beginn der nachfolgenden Ringvorlesung im Sommersemester 2024 erscheinen konnte und die Verschriftlichungen nur fast aller Vorträge vereint.
Beitragsskizzen
Die nachfolgenden Abrisse der jüngst publizierten Beiträge hat der der Verfasser dieses Beitrags und Band-Herausgeber in gekürzter und leicht abgewandelter Form seinem Vorwort entnommen. Die genauen Beitragstitel des Sammelbandes (sowie weitere Angaben) sind auf der Website der Ringvorlesungsreihe „ Memoranda Styriaca” dokumentiert.
Memoranda Styriaca” dokumentiert.
Unter Bezugnahme auf zwei vaterländische Geschichtsdramen der Grazer Schriftsteller Johann von Kalchberg (1765–1827) und Ignaz Kollmann (1775–1837) veranschaulicht Christian Neuhuber die kollektive und dabei eigendynamische Konstruktion steirischer Identitätsfiguren im Spannungsfeld historischer Umbrüche. In Kalchbergs Historien-Theaterstück „Die Ritterempörung” (1792) gewinnt die Hauptfigur des aufständischen Freiherrn Andreas Baumkircher, der 1471 in Graz trotz der Zusicherung freien Geleits hingerichtet worden war, wider die ursprüngliche Autorintention revolutionäres Potenzial. Die damit unfreiwillig grundgelegte Verehrung des Andreas Baumkircher als eines steirischen Identitätsstifters feierte jedoch erst durch lokale Wiederaufnahmen von Kalchbergs Theaterstück im späten, freiheitsideologisch vorangeschrittenen 19. Jahrhundert gleichsam ihren Durchbruch. Bei Kollmanns Geschichtsdrama „Carl von Österreich” (1832) schien angesichts des weitaus unverfänglicheren, weil absolut kaisertreuen Stoffes die Gefahr einer systemkritischen Auslegung zwar absolut ausgeschlossen, zumal die hochadelige Bühnenliebesgeschichte im identitätsspendenden Schatten des steirischen Erzbergs pünktlich zur Feier des 40-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz I. aufgeführt wurde, doch wieder waren es historische Bruchlinien, die eine andere Lesart durchaus zuließen, zumindest für intellektuelle Kreise in der Steiermark: Sie mochten in der Person des bekannt ‚umbruchsfreudigen’ Reformers und Bruders von Franz. I., Erzherzog Johann von Österreich, ihre Identifikationsfigur gefunden haben.
In zwei getrennten Beiträgen veranschaulicht Gernot Peter Obersteiner anhand der steirisch-innerösterreichischen Geschichte markante Wandlungsprozesse im Militärwesen sowie im Verwaltungsbereich, wobei als ein beides verbindendes, weil beiderseits dominantes Element die Getriebenheit aller Veränderungen durch die Notwendigkeit zur Sicherung finanzieller Herrschaftsressourcen hervortritt.
Sein Blick auf die steirische Verwaltungsgeschichte beginnt bei den Ausläufern der spätmittelalterlichen Habsburgerzeit und schweift von dort bis in die Frühe Neuzeit hinein. Als Dreh‑ und Angelpunkt aller verwaltungstechnischen Veränderungsprozesse erweist sich das Kräfteringen zwischen den landesfürstlichen und landständischen Instanzen. Nach dem aus steirischer Sicht vielversprechenden Machtzuwachs (in Folge der habsburgischen Länderteilung 1564) mit dem Wechsel des Regierungssitzes nach Graz brachte die Rückübersiedlung der Residenz nach Wien im Jahr 1619 einen Umschwung, und Anfang des 18. Jahrhunderts schlug das Pendel endgültig in Richtung „Wiener Zentralismus” aus – eine Entwicklung, die ab den 1740er-Jahren durch die hoch professionelle Maria-Theresianische Verwaltungsreform (inkl. Stärkung des Wiener Hofkriegsrates und der Besteuerung auch von Adel und Klerus) unumkehrbar gefestigt wurde.
Ebenso wechselhaft und dabei eng verwoben mit den verwaltungshistorischen sowie wieder mit finanziellen Aspekten präsentiert sich Obersteiners zweiter Beitrag: So war ebenso im Militärwesen seit jeher die Finanzkraft ausschlaggebend für die Größe, Ausrüstung und Einsatzbereitschaft eines Heeres, doch die Wege zu einer optimalen Absicherung des Heereswesens gestalteten sich – auch gemäß spezifischen Bedrohungslagen, in der Steiermark etwa durch die Osmanenangriffe – regional unterschiedlich und zeigten sich einmal mehr gekennzeichnet durch umbruchartige Veränderungen im Spannungsfeld von landesfürstlichen und landständischen Interessen. Die darauf reagierende Heeresreform durch die österreichische Landesfürstin und spätere Kaiserin Maria Theresia ermöglichte eine Loslösung des Heeresaufgebots von grundherrschaftlichen Rechten zugunsten der Etablierung eines stehenden, stets einsatzbereiten und gut geschulten Heeresverbandes. Nach der zwischenzeitlichen Einführung der Landwehrpflicht 1808, deren Ständisches Landesaufgebot an spätmittelalterliche Wehrideologien anknüpfte, erfolgte 1866 durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht unter Kaiser Franz Joseph die bis heute gültige Neufundierung des Militärwesens.
Gerald Lamprecht beleuchtet in seinem Beitrag zu Transformationen in der steirisch-jüdischen Geschichte entscheidende Wendepunkte im gesellschaftlichen Umgang mit der jüdischen Bevölkerung und macht klar, dass es keinesfalls gilt, eine separate Geschichte über das jüdische Leben zu schreiben, sondern dieses stets als Teil der allgemeinen Entwicklungen zu sehen. So darf die jüdische Bevölkerung schon im Mittelalter als eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft gelten, hat sie doch deren Entwicklung synergetisch mitgestaltet und dabei auch an der Bewältigung von mitunter krisenhaften Herausforderungen produktiv mitgewirkt. Von einer bewussten Verweigerung dieser Sicht zeugt etwa die massive Judenvertreibung unter Kaiser Maximilian I. Eine wirtschaftsgetriebene Rückholung der jüdischen Bevölkerung und ihrer Händler·innen erfolgte erst unter Kaiser Franz Joseph II., echte Rückansiedlungen kamen nach der massiven sozialen Umbruchszeit der 1848er-Jahre zustande. Dramatisch gestalteten sich für die jüdische Bevölkerung die Geschehnisse rund um den 1. Weltkrieg und – weitaus verheerender noch – den 2. Weltkrieg im Holocaust-Kontext von Flucht, Deportationen und Massentötungen. Einen mentalen Umbruch in der Gesellschaft durch kollektive Aufarbeitungsbemühungen brachten schließlich die späteren 1980er-Jahre.
Im Kontext globaler Entwicklungen zeichnet Elisabeth Schöggl-Ernst archivgeschichtliche Umbrüche nach und veranschaulicht einige der markantesten Ausprägungen am Beispiel des traditionsreichen Steiermärkischen Landesarchivs. Der Bogen spannt sich von der Anlage der allerältesten erhalten gebliebenen Tontafel-Archivstücke des 4. Jahrtausends v. Chr. über die späteren Sammlungen von papyrus‑, pergament‑ und papierbasierten Schriftträgern bis hin zum digitalen Archivzeitalter. Den besonderen, oft herrschaftlichen Wert vieler Archivalien als Informations‑ und Identitätsträger bezeugen etwa Kriegszeiten, in denen diese Quellen – ob ambulant oder ortsfest verwahrt – ganz gezielt feindlichen Nachstellungen und Vernichtungsabsichten ausgesetzt waren. Als entscheidende Umwälzung entpuppte sich dabei nicht allein die Durchsetzung des Zentralarchivprinzips im Laufe der Frühen Neuzeit, sondern im Gefolge der Französischen Revolution vor allem die europaweite Öffnung und Ausgestaltung von Archiven als nunmehr auch privat oder rein wissenschaftlich zugängliche Quellensammlungen. Eine sammlungsmethodische Wende markiert am Anfang des 20. Jahrhundets der Wechsel vom thematisch ordnenden Pertinenzprinzip hin zum herkunftsbezogenen Provenienzprinzip. Institutionsgeschichtlich bedeutend waren damit einhergehend zum einen der Statuswandel von Archiven von vormals untertänigen Empfängern von Materialien hin zu selbstbestimmt agierenden Anforderern relevanter Unterlagen sowie zum andern die universitäre Verankerung einer eigenständigen Archivwissenschaft, die sich dank ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung auch den aktuellen medientechnischen Umbrüchen gewachsen zeigt.
Den Anfang des wirtschaftsgeschichtlichen Abschlussblocks macht der Beitrag von Walter Iber mit seinem – auch österreichweiten – Blick auf die enorm umbruchsreiche Zeit zwischen 1918 und dem Ende des 2. Weltkriegs. Ökonomische Umbruchskräfte gingen vom Zerbrechen der Habsburgermonarchie und der rasanten Geldentwertung aus, was zu Massenarbeitslosigkeit führte. Nur kurz wirkte dem der Völkerbundkredit für die Erneuerung der steirischen Infrastruktur und für die Tourismusbelebung entgegen, bis die Weltwirtschaftskrise dazu führte, dass für die Steiermark 1933 kein Landesbudget mehr erstellt werden konnte, sie im Grunde also bankrott war. Einen Umschwung leitete ab 1938 die Rüstungswirtschaft ein: Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme sorgte sie in der Steiermark für Vollbeschäftigung, aber gegen Kriegsende für besonders schwere Luftangriffe der alliierten Streitmächte auf die stahl‑ und waffenproduzierenden Industriestandorte (inkl. Graz mit den österreichweit heftigsten Bombardierungen). Unmittelbar nach Kriegsende erfolgte die Demontage der noch verwertbaren Produktionsanlagen in der Steiermark durch die russische Besatzungsmacht. Veranschaulicht wird diese extrem wechselhafte – zwischenzeitlich dem Kriegsgewinnlertum nicht abgeneigte – Wirtschaftsgeschichte am Beispiel der steirischen Böhlerwerke.
Daran nahtlos anknüpfend, fokussiert Thomas Krautzer auf signifikante Bruchlinien und Gabelungen, welche den wirtschaftshistorischen Kurs der Steiermark auf ihrem Weg aus der Nachkriegsordnung bis in die Gegenwart begleitet bzw. gelenkt haben. Als Grenzland zwischen dem neu formierten Ost‑ und Westblock gelegen, schlugen hier die allgemeinen Währungsturbulenzen voll durch und führten zu bedrohlich hoher Inflation. Dem wirkte jedoch neben dem Marshallplan (mit seinem überproportional hohen Anteil zugunsten der Steiermark!) ein neues, kooperatives Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis entgegen, verbunden mit den ersten österreichweiten Industrieverstaatlichungen; 1973 wurde erstmals eine nicht kriegsgetriebene Vollbeschäftigungssituation erreicht. Doch augenblicklich verursachte die weltweite Ölpreiskrise einen negativen Umschwung, der mit einer sog. Stagflation einherging. Den Weg aus dieser massiven Krise zeigten Innovationen in Verbindung mit erfolgreichen Unternehmensprivatisierungen, darin zuvorderst mit eingeschlossen die stromerzeugende Industrie, welche in der Steiermark großteils in privater Hand belassen worden war. Der endgültige Aufbruch gelang für die Steiermark im Zuge des EU-Beitritts Österreichs 1994 und der Öffnung der wirtschaftlichen Ostgrenzen, denn damit wurde aus einem ehemaligen Grenzland ein neuer, wirtschaftlich erstarkter Zentralraum (!) im österreichischen und gesamteuropäischen Wirtschaftsgefüge.
Nachbetrachtung zu den Fragestellungen
Zurückgreifend auf die eingangs gestellte Frage und den Beitragstitel, kann also im Lichte aller Beiträge festgestellt werden, dass umbruchartige Veränderungsprozesse in der Gesellschaft keineswegs eine historische Ausnahme darstellen, sondern die Regel sind, wobei anfänglich zwar fast immer Verunsicherung herrscht, bewältigte Wandlungen oder Krisen im Rückblick jedoch häufig den Beginn einer nachhaltigen Fortschrittsbewegung markieren. Aber wie immer man das sehen mag: Die krisenerprobte Steiermark scheint durch jahrhundertelange Umbrüche aller Art eine wohl schon historisch zu nennende, gewiss auch in Zukunft hilfreiche Resilienz entwickelt zu haben!
Eine Art von vertiefter und zugleich weiterführender Reflexion dieses Befundes leistete im Sommersemester 2024 die Ringvorlesung „ Grenzüberschreitungen. Transdisziplinäre Betrachtungen herausragender Ereignisse, Ideen und Entwicklungen im Kontext der steirischen Landesgeschichte” (Abb. 3).[4] Das Buch dazu darf spätestens Anfang 2026 erwartet bzw. erhofft werden, rechtzeitig vor dem Start der nächsten Ringvorlesung, die – erstmals koordiniert vom HLK-Kollegen Christian Neuhuber – ab dem Herbst 2025 unter dem Titel „So ein Theater!” im Jahreslehrverzeichnis der Uni Graz aufscheinen wird.
Grenzüberschreitungen. Transdisziplinäre Betrachtungen herausragender Ereignisse, Ideen und Entwicklungen im Kontext der steirischen Landesgeschichte” (Abb. 3).[4] Das Buch dazu darf spätestens Anfang 2026 erwartet bzw. erhofft werden, rechtzeitig vor dem Start der nächsten Ringvorlesung, die – erstmals koordiniert vom HLK-Kollegen Christian Neuhuber – ab dem Herbst 2025 unter dem Titel „So ein Theater!” im Jahreslehrverzeichnis der Uni Graz aufscheinen wird.
Anmerkungen
[1] Zu den ersten beiden Ringvorlesungen 2018 und 2020 siehe die Blogbeiträge „ Steirische Geschichtsforschung im Hörsaal" und „
Steirische Geschichtsforschung im Hörsaal" und „ Unbeirrbare Geschichtsforschung: Leitgedanken zum Vorlesungs-Sammelband „Fälschung! Eine fächerübergreifende Spurensuche in der steirisch-innerösterreichischen Landesgeschichte".
Unbeirrbare Geschichtsforschung: Leitgedanken zum Vorlesungs-Sammelband „Fälschung! Eine fächerübergreifende Spurensuche in der steirisch-innerösterreichischen Landesgeschichte".
[2] Siehe dazu die  Homepagemeldung der Universität Graz vom 25. Februar 2022.
Homepagemeldung der Universität Graz vom 25. Februar 2022.
[3] Wernfried Hofmeister (Hg.), Umbruchszeiten. Epochale Krisen und Neuanfänge im Spiegel der steirischen Landesgeschichte (= Memoranda Styriaca. Lehrkooperationsbeiträge Uni Graz – Historische Landeskommission für Steiermark 3, Graz 2025), 312 Seiten. Gemäß dem im Herbst 2019 besiegelten Kooperationsvertrag obliegt der HLK die Lehrveranstaltungs-Koordinierung sowie die Publikation der Ergebnisse, das Vizerektorat der Universität Graz sorgt für die Dotierung der Lehre. Die  Buchpräsentation fand am 5. März 2025 im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs statt, begleitet durch Grußworte von Vizerektorin Catherine Walter-Laager.
Buchpräsentation fand am 5. März 2025 im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs statt, begleitet durch Grußworte von Vizerektorin Catherine Walter-Laager.
[4] Siehe dazu die ankündigende Homepagemeldung der Universität Graz vom 23. Februar 2024.
Neuerscheinung: Wernfried Hofmeister (Hg.), Umbruchszeiten. Epochale Krisen und Neuanfänge im Spiegel der steirischen Landesgeschichte (= Memoranda Styriaca. Lehrkooperationsbeiträge Uni Graz – Historische Landeskommission für Steiermark 3, Graz 2025), 312 Seiten. (
Wernfried Hofmeister (Hg.), Umbruchszeiten. Epochale Krisen und Neuanfänge im Spiegel der steirischen Landesgeschichte (= Memoranda Styriaca. Lehrkooperationsbeiträge Uni Graz – Historische Landeskommission für Steiermark 3, Graz 2025), 312 Seiten. ( Inhaltsverzeichnis)
Inhaltsverzeichnis)
Das Buch ist im Buchhandel oder bei der HLK (Karmeliterplatz 3, 8010 Graz, 0316/877-3013, hlk@stmk.gv.at) um € 30,- erhältlich.
Ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Wernfried Hofmeister, Studium der Germanistik und Anglistik in Graz, Promotion 1981, nach Habilitation 1995 Ao. Univ.-Prof. für Deutsche Sprache und Ältere Deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Graz, seit 2019 Geschäftsführender Sekretär der Historischen Landeskommission für Steiermark. Forschungsschwerpunkte: Editionswissenschaft, historische Metaphern- und Phraseologieforschung, spätmittelalterliche Dichtung, regionale Literaturforschung und ihre mediale Vermittlung.